Einst trockengelegte Moore wieder zu vernässen, könnte einen riesigen Klimaschutzeffekt haben. Doch es geht nur schleppend voran, es fehlt an Investitionen und politischen Anreizen. Kann die sogenannte „Paludikultur“, also Landwirtschaft im nassen Moor, dennoch Erfolg haben?
Die neuesten Zahlen der Internationalen Union für Naturschutz (IUCN) zu entwässerten Torfmooren und zum Klimawandel sind erschreckend. Obwohl diese trockengelegten Feuchtgebiete nur 0,3 % der globalen Landmasse bedecken, stoßen sie jedes Jahr 1,9 Gigatonnen Kohlendioxid aus – das entspricht 5 % der weltweiten anthropogenen Treibhausgasemissionen.
Dieser außergewöhnlich hohen Werte machen deutlich, wie wichtig Moore sind, um Kohlenstoffemissionen zu senken und den Klimawandel zu bekämpfen. Feuchtgebiete speichern mehr Kohlenstoff als alle anderen Vegetationstypen auf der Welt und bewahren neben ihrer enormen Speicherkraft auch die biologische Vielfalt, verbessern die Wasserqualität und minimieren das Hochwasserrisiko.
„Wenn es um Vorschriften, Gesetze, Subventionen und die Frage geht, wer jetzt und in Zukunft die Kosten trägt, dann wird alles auf eine auf Entwässerung basierende Landwirtschaft ausgerichtet.“
Professor Christian Fritz, Moorwissenschaftler
Das kann Land- und Forstwirtschaft im nassen Moor
Angesichts der eindeutigen Vorteile für das Klima ist es nicht verwunderlich, dass die „Paludikultur“ an Dynamik gewinnt und neue Märkte entstehen. Darunter versteht man die land- und forstwirtschaftliche Nutzung von nassen Mooren.
Für Schilf oder Reet gibt es bereits einen globalen Markt: als Material zum Dachdecken. Aber auch andere Pflanzen aus dem Moor lassen sich vielfältig nutzen. Das prominenteste Beispiel ist die aus Nordamerika stammende Cranberry. Diese gilt in Europa – beispielsweise auf Sylt – allerdings als invasiv und sollte daher nicht landwirtschaftlich angebaut werden. Ihr heimischer Verwandter, die gewöhnliche Moosbeere, kommt bisher nur als Wildsammlung auf den Markt.
Die bedrohten Moorpflanzen Gagelstrauch, Moltebeere und Sonnentau sind mit ihren Inhaltsstoffen für Medizin und Kosmetik attraktiv, Wasserminze wird zu Tee verarbeitet. Rohrkolben, Rohrglanzgras und Schilf können zur Isolation, als Einstreu in der Viehhaltung, in der Papier- und Verpackungsindustrie oder zur Energiegewinnung verwendet werden.
Feuchtgebiete haben in der Landwirtschaft also großes Potenzial. Doch noch nutzt sie kaum jemand entsprechend, weltweit gibt es nur wenige tausend Hektar Paludikultur. Warum? Ein großer Teil der Antwort liegt in Vorschriften und Regeln, der andere in den hohen Investitionskosten für Maschinen zur Bewirtschaftung und Weiterverarbeitung.

Gesetze und Vorschriften behindern
Professor Christian Fritz ist Moorwissenschaftler und Öko-Hydrologe an der Radboud-Universität in den Niederlanden. Gemeinsam mit 13 Partnern aus acht europäischen Ländern erforscht er im Projekt WET HORIZONS die Umsetzbarkeit der Moor-Bewirtschaftung. Er ist sich sicher, dass die heutige Gesetzgebung falsche Anreize setzt.
Fritz sagt: „Vor diesem Hintergrund ist die Paludikultur einfach nicht vorhanden.“
Dr. Anke Nordt, Paludikultur-Forscherin am Institut für Botanik und Landschaftsökologie der Universität Greifswald, stimmt Fritz zu. Sie hebt auch hervor, wie die lange Geschichte und das enorme Ausmaß der Entwässerung von Mooren die heutigen politischen Rahmenbedingungen geprägt haben. Als Beispiel nennt sie die Gemeinsame Agrarpolitik der EU: „Sie schützt einerseits Feuchtgebiete und Moore, doch es gibt weiterhin Subventionen für die Landwirtschaft auf entwässerten Mooren.“
In ähnlicher Weise helfen die EU-Wasserrahmenrichtlinie und das deutsche Wasserhaushaltsgesetz, die beide dem Schutz von Gewässern dienen sollen, Wiedervernässungsprojekten nicht. „Die EU-Wasserrahmenrichtlinie schützt einen Wasserlauf und seine Arten, die vor zehn Jahren, als das Land entwässert wurde, vorhanden waren“, sagt Nordt.
Mark Reed, Professor am Scotland’s Rural College in Edinburgh und Autor des „Research Impact Handbooks”, sieht vor allem in einer anwendungsorientierten Forschung die Lösung:
„Es ist an der Zeit, dass die Forschung im Bereich des Klimawandels einen neuen Schwerpunkt setzt: von der Erforschung der Ursachen hin zur Entwicklung konkreter Lösungen.“
Andere Akteure sprechen sich gegen eine weitere Regulierung aus und wollen die Entwicklungen lieber dem Markt überlassen. Trotz vieler Unklarheiten gibt es Fortschritt: Projekte wie WET HORIZONS, ALFAwetlands, MOOSland und PRINCESS erforschen wirtschaftliche Möglichkeiten zur Wiedervernässung von Mooren. Die in Deutschland ansässige Initative toMOORow, der 14 namhafte Unternehmen hauptsächlich aus der Bau-, Verpackungs-, Dämmstoff-, Holz- und Papierindustrie angehören, baut Wertschöpfungsketten für Moor-Produkte auf. Auch gründen sich immer mehr Start-ups zum Thema.
In Zusammenarbeit mit der Universität Greifswald hat „Moor and More“ ein kleines Haus aus Paludikulturprodukten gebaut, um zu demonstrieren, was dieses Landwirtschaftssystem leisten kann. Die Initiative „ZukunftMoor“ hat sich mit dem Greifswald Moor Centrum und der in Greifswald ansässigen Succow-Stiftung zusammengetan und renaturiert Moore mit einer Fläche von 20 Hektar oder mehr, um Torfmoos anzubauen. Auch dieses Start-up hofft, weitere Investor:innen sowie Partner:innen aus Wirtschaft und Wissenschaft für die Weiterentwicklung der Produktion zu gewinnen.
Fazit: Die Land- und Forstwirtschaft im nassen Moor bietet viel Potenzial und trägt nachhaltig zum Klimaschutz bei. Es wäre wünschenswert, dass sie sich auf vielen ehemaligen Mooren durchsetzt.
Dieser Text wurde bereitgestellt vom European Science Communication Institute (ESCI) und von der Utopia-Redaktion geprüft und überarbeitet.
Autorinnen: Dianna Bautista & Rebecca Pool
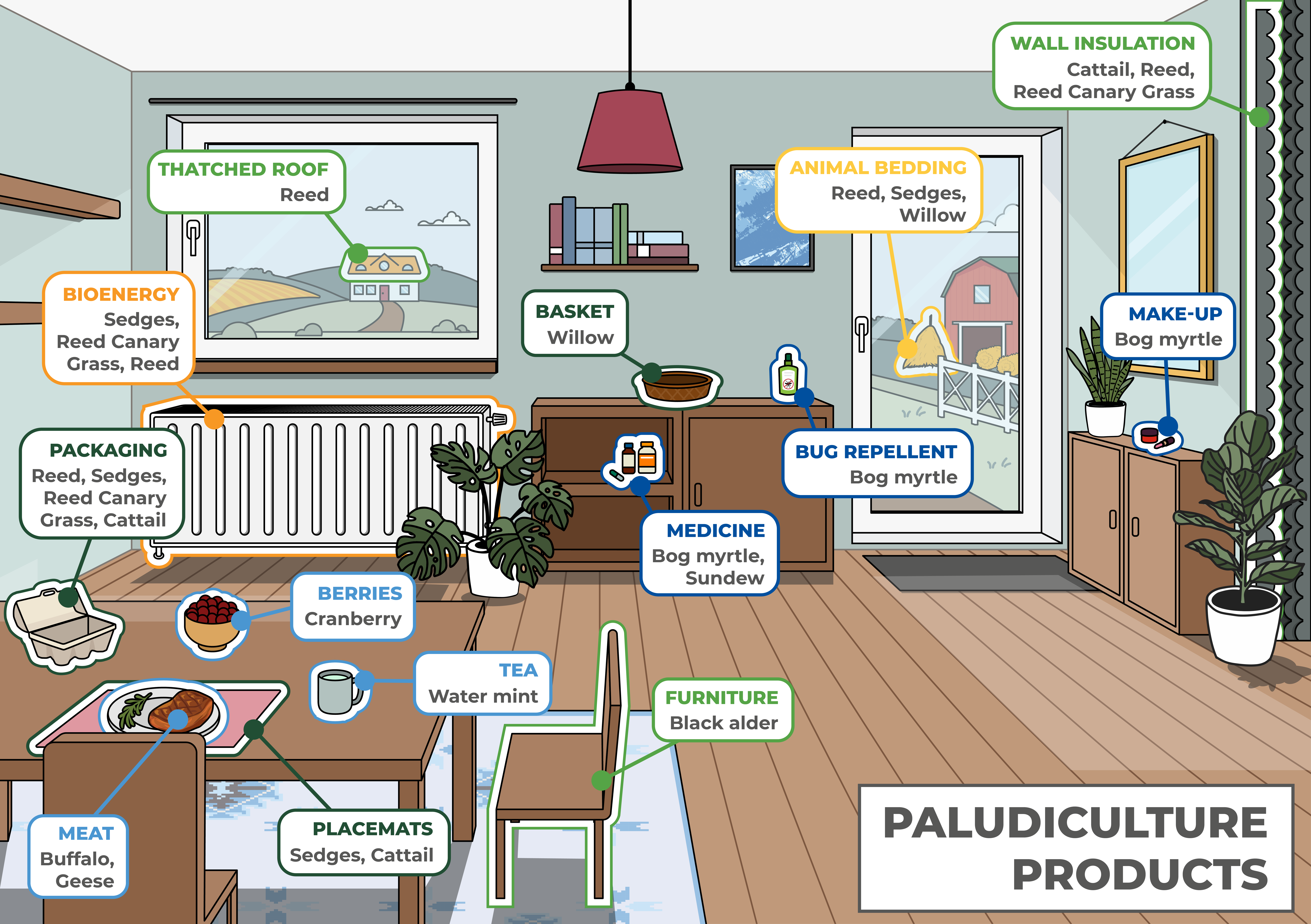
English version:
Rewetting wetlands that were once drained could have a huge impact on climate protection. However, progress is slow due to a lack of investment and political incentives. Can so-called ‘paludiculture’, or agriculture in peatlands, still be successful?
The latest figures from the International Union for Conservation of Nature (IUCN) on drained peat bogs and climate change are alarming. Although these drained wetlands cover only 0.3% of the global land mass, they emit 1.9 gigatonnes of carbon dioxide every year – equivalent to 5% of global anthropogenic greenhouse gas emissions.
These exceptionally high figures make it clear how important wetlands are for reducing carbon emissions and combating climate change. Wetlands store more carbon than any other type of vegetation in the world. In addition to their enormous storage capacity, they also preserve biodiversity, improve water quality and minimise flood risk.
There is already a global market for reed or thatch as a roofing material. But other plants from wetlands can also be used in a variety of ways. The most prominent example is the cranberry, which originates from North America. In Europe, however, it is considered invasive and should therefore not be cultivated agriculturally. Its native relative, the common cranberry, is currently only available on the market as a wild collection.
The threatened bog plants, bog myrtle, cloudberry and sundew, are attractive for medicine and cosmetics with their ingredients, while water mint is processed into tea. Bulrush, reed canary grass and reed can be used for insulation, as bedding in livestock farming, in the paper and packaging industry or for energy generation.
Wetlands therefore have great potential in agriculture. However, they are still rarely used for this purpose, and there are only a few thousand hectares of paludiculture worldwide. Why is this? A large part of the answer lies in rules and regulations, and another part in the high investment costs for management and processing machinery.
Laws and regulations are hindering
Professor Christian Fritz is a peatland scientist and eco-hydrologist at Radboud University in the Netherlands. Together with 13 partners from eight European countries, he is researching the feasibility of peatland management in the WET HORIZONS project. He is certain that current legislation sets the wrong incentives.
Fritz says: ‘In this context, paludiculture is simply not there.’
Dr Anke Nordt, a paludiculture researcher at the Institute of Botany and Landscape Ecology at the University of Greifswald, agrees with Fritz. She also highlights how the long history and enormous extent of peatland drainage have shaped today’s policy frameworks. She cites the EU’s Common Agricultural Policy as an example: ‘On the one hand, it protects wetlands and peatlands, but subsidies for agriculture on drained peatlands continue to be paid.’
Similarly, the EU Water Framework Directive and the German Water Resources Act, both of which are supposed to protect water bodies, do not help rewetting projects. ‘The EU Water Framework Directive protects a watercourse and its species that were present ten years ago when the land was drained,’ says Nordt.
The way forward: these projects advocate for paludiculture
The researchers advocate an EU-managed demand buffer that promises security for the farmers involved. Put simply, governments should buy up peatland products for further processing. ‘If there are delays on the industry side, [the harvest] can at least find one or two alternative uses,’ says Fritz. ’Governments have made huge investments in having both demand and supply buffers in the natural gas and petrol markets – this is a very common practice.’
Mark Reed, professor at Scotland’s Rural College in Edinburgh and author of the ‘Research Impact Handbook’, sees the solution as being application-oriented research:
‘It is time for research on climate change to set a new focus: from exploring the causes to developing concrete solutions.’
Other actors are opposed to further regulation and would rather leave developments to the market. Despite the many uncertainties, progress is being made: projects such as WET HORIZONS, ALFAwetlands, MOOSland and PRINCESS are exploring economic opportunities for the rewetting of peatlands. The Germany-based toMOORow initiative, which includes 14 well-known companies mainly from the construction, packaging, insulation, wood and paper industries, is building value chains for peatland products. More and more start-ups are also being founded on the topic.
In collaboration with the University of Greifswald, Moor and More has built a small house out of paludiculture products to demonstrate what this agricultural system can achieve. The ZukunftMoor initiative has joined forces with the Greifswald Mire Centre and the Succow Foundation, also based in Greifswald, to restore peatlands with an area of 20 hectares or more to grow peat moss. This start-up also hopes to attract further investors and partners from industry and science to help develop production.
Conclusion: agriculture and forestry in peatlands offers great potential and makes a sustainable contribution to climate protection. It would be desirable if it were to be implemented on many former peatlands.
This text was provided by the European Science Communication Institute (ESCI) and reviewed and edited by the Utopia editorial team.
Authors: Dianna Bautista & Rebecca Pool